
In den letzten Jahren hat sich unsere Art zu kaufen und zu konsumieren grundlegend verändert. Ein besonders prägnantes Beispiel dafür ist der Labubu-Hype. Die kleinen, farbenfrohen Figuren im „Blind Box“-Format haben nicht nur TikTok und Instagram erobert, sondern auch die Herzen von Sammlern auf der ganzen Welt.
Dieser Artikel soll das Phänomen näher beleuchten. Wir fragen uns, warum wir uns so leicht von Konsumwellen mitreißen lassen, welche psychologischen Mechanismen den viralen Hype antreiben und weshalb sozialer Druck dabei eine so starke Rolle spielt. Zudem werfen wir einen Blick auf die Psychologie des Kaufens, den Einfluss von FOMO, die Folgen exzessiven Sammelns sowie auf Alternativen, die uns helfen können, bewusster zu entscheiden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Labubu-Phänomen und der virale Hype
3. Der Mechanismus der „Blind Boxen“ und die Psychologie von FOMO
4. Überkonsum in der Praxis: was nach dem Kauf passiert
5. Gesellschaftliche Folgen von zwanghaftem Kaufen
6. Alternativen: bewusster Konsum und Öko-Gadgets
7. Fazit
8. FAQ
Das Labubu-Phänomen und der virale Hype
Die kleinen, verspielten Labubu-Figuren haben sich zu einem der auffälligsten Symbole moderner Konsumkultur entwickelt. Sie stammen vom Hongkonger Künstler Kasing Lung und werden von POP MART produziert. Inzwischen erfreuen sie sich weltweit großer Beliebtheit. Obwohl sie auf den ersten Blick nur Spielzeug sind, geht ihre Bedeutung weit darüber hinaus – sie gelten heute als modisches „Must-have“ und Lifestyle-Statement, befeuert durch soziale Medien und cleveres virales Marketing.
Wie soziale Medien Konsumtrends antreiben
Plattformen wie TikTok, Instagram und YouTube spielen die Hauptrolle beim Labubu-Boom. Nicht klassische Werbung bestimmt, was angesagt ist, sondern die Funktionsweise der Algorithmen.
-
Unboxing-Clips von „Blind Boxen“ mit Labubu-Figuren erreichen Millionen von Views.
-
Hashtags wie #Labubu, #POPmart oder #BlindBox trenden weltweit.
-
Influencer stellen ihre Sammlungen vor und erzeugen damit sozialen Druck, die neuesten Editionen ebenfalls besitzen zu wollen.
So kaufen wir nicht mehr aus echtem Bedarf heraus, sondern weil es gerade angesagt ist. Die sozialen Medien vermitteln uns das Gefühl: Ohne Labubu gehörst du nicht dazu.
Labubu als unverzichtbares Sammlerstück
Der besondere Reiz der Labubu-Figuren liegt in ihrem emotionalen, nicht aber praktischen Wert. Sie haben keinen funktionalen Nutzen, sind jedoch zu einem Symbol für Status und Zugehörigkeit innerhalb einer Subkultur geworden.
Sammler sind ständig auf der Suche nach den seltensten Ausgaben. Limitierte Editionen dienen dabei als Mittel, sich online und im Freundeskreis hervorzuheben. POP MART nutzt bewusst die Verknappung bestimmter Modelle, um Exklusivität zu erzeugen. Jeder neue Release wird so zu einem Wettlauf – nur wer schnell reagiert, hat die besten Chancen.
Wie TikTok, Instagram und Influencer den Hype verstärken
Vor allem die sozialen Medien haben Labubu an die Spitze der Trends gebracht:
-
TikTok – kurze, dynamische Clips vom Auspacken der „Blind Boxen“ wirken wie ein visuelles Glücksspiel. Zuschauer fiebern mit, ob eine limitierte Figur dabei ist.
-
Instagram – Sammler inszenieren ihre Figuren in stilvollen Galerien und machen Labubu damit zu einem Lifestyle-Accessoire.
-
Influencer – viele erhalten die neuesten Serien als Erste und erzeugen damit das Gefühl, man müsse mitziehen, um nicht zurückzubleiben.
Auffällig ist, dass der Hype weitgehend organisch gewachsen ist – die Community selbst produziert Inhalte, die das Interesse immer weiter antreiben. Schon wenige virale Clips genügen, damit neue Serien in kürzester Zeit ausverkauft sind.
Das Prinzip der „Blind Boxen“ und die Psychologie hinter FOMO
Der enorme Erfolg der Labubu-Figuren basiert in hohem Maße auf dem Verkaufskonzept der „Blind Boxen“. Es handelt sich dabei nicht nur um eine clevere Marketingstrategie – dahinter steckt ein gezielt entwickeltes psychologisches Modell, das unser Belohnungssystem, Dopaminausschüttungen und sozialen Druck ausnutzt.
Was macht „Blind Boxen“ so wirkungsvoll auf unser Gehirn?
„Blind Boxen“ sind kleine Verpackungen, die jeweils eine Figur aus einer Serie enthalten. Der Käufer erfährt erst beim Öffnen, welches Modell er erhält – der gesamte Inhalt bleibt bis dahin ein Geheimnis. Bei Labubu bestehen die von POP MART produzierten Serien in der Regel aus mehreren Varianten:
-
Standardfiguren – in großer Zahl verfügbar,
-
Limitierte Ausgaben – deutlich seltener und schwer zu ergattern,
-
„Chase Figures“ – extrem seltene Exemplare, die bei Sammlern besonders begehrt sind.
Dieses Prinzip funktioniert nach dem Muster eines Glücksspiels. Man bezahlt nicht nur für die Figur selbst, sondern auch für das Erlebnis des Auspackens. Der Vorgang erinnert an Spielautomaten: Mit jedem Öffnen steigt Spannung und Nervenkitzel. Gerade diese Unsicherheit führt dazu, dass man immer wieder zugreift – und die nächste Box kauft.
Die Bedeutung von Dopamin im Kaufprozess
Unsere Begeisterung für Blind Boxen hat ihre Wurzeln im Belohnungssystem des Gehirns. Sobald uns etwas fasziniert, wird Dopamin ausgeschüttet – ein Neurotransmitter, der Gefühle von Freude und Motivation erzeugt.
Am Beispiel von Labubu lässt sich dieser Ablauf deutlich erkennen:
-
Vorfreude – schon beim Kauf steigt die Spannung, da die Aussicht auf ein seltenes Modell lockt.
-
Enthüllung – der Augenblick des Auspackens löst einen starken Dopamin-Kick aus.
-
Erfolg oder Enttäuschung – bei einem Treffer ist die Freude riesig; bleibt er aus, will man sofort noch einmal kaufen, um den vermeintlichen Verlust wettzumachen.
Diese Mischung aus Unsicherheit und Belohnung aktiviert dieselben Reize wie Glücksspielautomaten. POP MART ist sich dieser Wirkung bewusst und limitiert gezielt bestimmte Modelle, um Exklusivität und Konkurrenzdruck zu steigern.
FOMO – sozialer Druck und das Gefühl, dazugehören zu müssen
Das Phänomen FOMO (Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen) ist ein wesentlicher Antrieb beim Kauf von Labubu-Figuren. Soziale Medien verstärken diesen Druck erheblich:
-
Auf TikTok und Instagram tauchen ständig Clips von Sammlern auf, die die neuesten Serien ergattert haben.
-
In Online-Communities präsentieren immer mehr Fans stolz ihre Errungenschaften.
-
So entsteht das Gefühl, unbedingt dabei sein zu müssen – andernfalls verpasst man etwas Bedeutendes.
FOMO erreicht seinen Höhepunkt, sobald limitierte Editionen ins Spiel kommen. Das Wissen, dass eine bestimmte Figur womöglich nie wieder erhältlich ist, verstärkt den Druck, sofort zuzuschlagen.
Überkonsum im Alltag: Was geschieht nach dem Kauf?
Wir kaufen, packen aus, freuen uns – und danach landet die Figur auf dem Regal. Was zunächst wie eine Quelle der Freude wirkt, verwandelt sich schnell in ein weiteres Objekt einer wachsenden Staubansammlung. Das Labubu-Phänomen verdeutlicht das größere Problem des Überkonsums: immer mehr Dinge zu erwerben, die wir gar nicht brauchen, nur um für einen kurzen Moment ein Gefühl von Aufregung zu erleben.
Zugestellte Wohnungen, wachsendes Chaos und „Staub-Sammlungen“
Die Labubu-Figuren sind zwar klein, doch eines ist ihnen gemeinsam: Es werden immer mehr. Für viele beginnt mit dem Kauf von ein oder zwei Figuren eine unaufhaltsame Sammelspirale:
-
Weitere Serien werden gekauft, weil „noch fehlende Modelle“ unbedingt ergattert werden müssen.
-
Neue Editionen werden bestellt, noch bevor die vorherigen ausgepackt sind.
Das Ergebnis: Unsere Wohnbereiche füllen sich zunehmend mit Gegenständen. Die Figuren verlieren ihren besonderen Wert als Erinnerung und werden Teil einer Ansammlung, die lediglich Staub ansetzt. Das ist das Paradox des modernen Sammelns – die Jagd nach Neuem führt eher zu Unordnung als zu echter Zufriedenheit.
Das Paradox der Zufriedenheit: Warum Kaufen uns nicht dauerhaft glücklich macht
Die Konsumpsychologie verdeutlicht, dass das Glücksgefühl beim Kauf nur von kurzer Dauer ist. Der Ablauf lässt sich so beschreiben:
-
Vor dem Kauf – die Aussicht auf ein besonderes Stück versetzt uns in Euphorie.
-
Während des Kaufs – wir erleben einen Dopamin-Kick und spüren Glück.
-
Nach dem Kauf – die Euphorie lässt rasch nach, die Emotionen kühlen ab.
-
Kurz darauf – wir suchen die nächste „Belohnung“.
Das „hedonische Hamsterrad“ — die ständige Suche nach Neuem
Dieses Phänomen, das von Psychologen als hedonisches Hamsterrad (hedonic treadmill) bezeichnet wird, ist zentral, um den Überkonsum zu verstehen. Es verläuft folgendermaßen:
-
Beim Erwerb von etwas Neuem verspüren wir ein kurzes Glücksgefühl.
-
Schon nach kurzer Zeit gewöhnt sich das Gehirn daran und die Freude lässt nach.
-
Um dieses Gefühl wiederzuerlangen, brauchen wir etwas Neues.
-
So setzt sich der Kreislauf endlos fort.
Gesellschaftliche Auswirkungen von Kaufzwang
Das Labubu-Phänomen ist weit mehr als ein kurzer Trend – es spiegelt tiefgreifende Veränderungen in unserer Konsumkultur wider. Einerseits treiben uns psychologische Faktoren wie das Streben nach Dopamin zu häufigeren Käufen. Andererseits führen hohe Produktionsmengen und die kurze Lebensdauer der Produkte zu erheblichen Folgen für Umwelt und Lebensgewohnheiten.
Wie die Kultur der Sofort-Belohnung unser Verhalten prägt
Der moderne Konsument lebt in einer Welt, in der sofortige Befriedigung allgegenwärtig ist. Soziale Medien, Werbung und die Algorithmen von Online-Shops überschwemmen uns mit Impulsen, die uns zu spontanen Entscheidungen verleiten sollen: „jetzt kaufen“.
Dieser Mechanismus beschränkt sich nicht nur auf Figuren. Er zeigt sich auch in anderen Bereichen: Fast Fashion, Elektronik, Kosmetik, Mobile Games … Wir leben in einer Konsumkultur, die nach „mehr“ und „schneller“ strebt, während echte Bedürfnisse immer seltener die Grundlage für Kaufentscheidungen sind.
Umweltbelastung: Mikroplastik, Abfall und CO₂-Emissionen
Mit jeder Labubu-Figur holen wir uns auch ein Stück Umweltproblem ins Haus. Einzelne Figuren scheinen unbedeutend, doch im großen Maßstab sind die Auswirkungen enorm:
1. Mikroplastik und Abfälle
-
Die von POP MART hergestellten Labubu-Figuren bestehen hauptsächlich aus Vinyl und anderen Kunststoffen.
-
Die Produktion dieser Materialien führt zu Abfällen, die nur schwer entsorgt werden können.
-
Gelangen die Figuren schließlich auf Mülldeponien, zersetzen sie sich langsam und setzen dabei Mikroplastik in Erde und Gewässer frei.
2. Verpackungsflut
Die „Blind Boxen“ verschärfen das Problem erheblich:
-
Jede Figur steckt in einem Karton, der zusätzlich mit einer Plastikfolie ausgekleidet ist.
-
Wer gleich mehrere oder ein Dutzend Boxen kauft, produziert dadurch enorme Mengen an Abfall – fast ausschließlich aus Einwegmaterialien.
3. CO₂-Bilanz
-
Die Produktion der Labubu-Figuren erfolgt überwiegend in Asien, bevor sie in alle Teile der Welt geliefert werden.
-
Der internationale Transport per Schiff und Flugzeug erhöht die CO₂-Emissionen erheblich.
-
Hinzu kommt: Die wachsende Nachfrage nach neuen Serien erzwingt eine intensive Fertigung, die sowohl Energie als auch natürliche Ressourcen beansprucht.
Alternativen: Bewusster Konsum und Öko-Gadgets
Sobald man versteht, wie der Mechanismus des Überkonsums wirkt, stellt sich die Frage, wie man aus dieser Spirale ausbrechen kann. Ein zunehmendes Umweltbewusstsein und das Streben nach Minimalismus führen dazu, dass immer mehr Menschen nach Alternativen suchen – nach Produkten, die langlebig, praktisch und ressourcenschonend sind.
Kaufrausch eindämmen – konkrete Tipps
Man muss nicht vollständig auf die Freude am Einkaufen verzichten. Stattdessen lohnt es sich, ein bewussteres Einkaufsverhalten zu entwickeln. Einige hilfreiche Strategien sind:
-
Erstelle eine Einkaufsliste – frage dich vor dem Kauf, ob du den Artikel wirklich benötigst oder ob es sich nur um einen spontanen Wunsch handelt.
-
Warte ab – wenn dich ein Produkt reizt, gib dir 24 bis 48 Stunden Zeit. Oft verfliegt die Lust am Kauf danach.
-
Lege ein Budget für Extras fest – so kannst du dir kleine Freuden gönnen, ohne die Kontrolle zu verlieren.
-
Wertschätze das, was du besitzt – bevor du eine weitere Figur kaufst, schaue deine Sammlung an. Brauchst du wirklich noch eine, oder folgt der Wunsch nur dem Trend?
-
Setze auf Qualität statt Masse – Produkte, die langlebig, funktional und umweltschonend sind, bringen dauerhaftere Zufriedenheit.
Mit diesem Ansatz behältst du nicht nur deine Ausgaben besser unter Kontrolle, sondern reduzierst gleichzeitig Unordnung und deinen ökologischen Fußabdruck.
Minimalismus und „Less Waste“ als wachsende Trends
Immer mehr Menschen erkennen, dass Wenigerhaben auch Mehrwert bedeuten kann. Minimalismus bedeutet nicht den kompletten Verzicht, sondern die bewusste Auswahl von Dingen, die tatsächlich Bedeutung und Nutzen haben.
-
Minimalismus inspiriert dazu, sich mit langlebigen, nützlichen und zugleich ansprechenden Produkten zu umgeben.
-
Less Waste legt den Fokus auf die Reduktion von Abfall durch den Einsatz von Mehrwegartikeln oder recycelbaren Materialien.
-
So kaufen wir insgesamt weniger, dafür qualitativ hochwertiger – Produkte, die uns über Jahre hinweg begleiten, statt lediglich Staub zu sammeln.
Naturkork – ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit
Naturkork gilt als eines der besten Beispiele für umweltfreundliche Produktion. Dieser erneuerbare Rohstoff stammt aus der Rinde der Korkeiche und bietet ein enormes Potenzial für nachhaltige Alltagsprodukte und umweltbewusste Gadgets.
Was macht Naturkork besonders umweltfreundlich?
-
Bei der Ernte wird lediglich die Rinde entfernt, ohne den Baum zu fällen – die Korkeiche lebt weiter und bildet neue Rinde.
-
Die Verarbeitung erzeugt kaum Abfall und hinterlässt nahezu keinen CO₂-Fußabdruck.
-
Naturkork ist vollständig biologisch abbaubar und recycelbar.
Kork-Gadgets im Alltag
-
Yoga- und Fitnessmatten – rutschfest, robust und natürlich feuchtigkeitsabweisend.
-
Dekorationen und Globen – leicht, formschön und designorientiert.
-
Thermobecher und dekorative Untersetzer – stilvoll und praktisch zugleich.
-
Kugelschreiber – angenehm im Griff und nachhaltig produziert.
-
Portemonnaies, Etuis, Taschen und Rucksäcke – federleicht, widerstandsfähig und wasserabweisend.
-
Regenschirme – die nachhaltige Alternative zu Plastikvarianten.
-
Sandalen und Schuhe – elastisch, bequem und atmungsaktiv.
-
Organizer für den Schreibtisch – praktische und stilvolle Ordnungssysteme.
-
Bilderrahmen – schlicht, elegant und naturbelassen.
-
Computermaus – ergonomisch geformt, leicht und angenehm in der Handhabung.
Zusammenfassung
Das Beispiel der Labubu-Figuren macht deutlich, wie stark soziale Medien, das Blind-Box-Konzept und der FOMO-Effekt unsere Kaufentscheidungen beeinflussen. Wir lassen uns von der Spannung des Auspackens, der Jagd nach limitierten Editionen und dem sozialen Druck „alle haben es“ mitreißen. Doch die anfängliche Euphorie vergeht schnell, und weitere Käufe führen oft nur zu vollen Regalen, Unordnung und Unzufriedenheit.
Eine echte Alternative ist bewusster Konsum – also die Entscheidung für langlebige, praktische und nachhaltige Produkte. Besonders gut eignen sich dafür Accessoires aus Naturkork, die Design, Funktionalität und Umweltfreundlichkeit verbinden. Anstatt eine weitere Figur zu kaufen, deren Reiz rasch nachlässt, können wir in Dinge investieren, die uns viele Jahre begleiten und zugleich die „Less Waste“-Idee unterstützen.
FAQ – Häufig gestellte Fragen
1. Woran erkenne ich, dass ich in eine Überkonsum-Spirale geraten bin?
Wenn du Figuren oder andere Dinge spontan kaufst und die meisten davon ungenutzt im Regal stehen, ist das ein klares Warnsignal. Achte auf deine Gefühle: Sind Einkäufe eine Reaktion auf Langeweile, Gruppendruck oder Stress, solltest du innehalten.
2. Was kann ich mit Figuren machen, die ich nicht mehr behalten möchte?
Statt sie wegzuwerfen, gibt es sinnvolle Alternativen:
-
Verkauf auf Sammlerplattformen,
-
Tausch in Fangruppen,
-
Schenke sie jemandem, der wirklich Freude daran hat.
Dadurch reduzierst du Abfall und gibst den Gegenständen ein zweites Leben.
3. Wie vermeide ich Käufe aus FOMO?
-
Nutze die „24-48-Stunden-Regel“ – warte, bevor du kaufst.
-
Schalte Benachrichtigungen zu Neuerscheinungen und Rabatten aus, wenn sie dich unter Druck setzen.
-
Mach dir bewusst: Was heute im Trend liegt, kann morgen schon vergessen sein.
4. Warum lohnt es sich, Produkte aus Naturkork zu wählen?
Naturkork ist ein natürlicher, nachwachsender Rohstoff mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Ob Fitnessmatten, Untersetzer, Geldbörsen, Bilderrahmen, Organizer, Becher oder sogar Computermäuse – Korkprodukte sind langlebig, funktional und ästhetisch. Damit senkst du Abfälle und unterstützt die „Less Waste“-Bewegung.
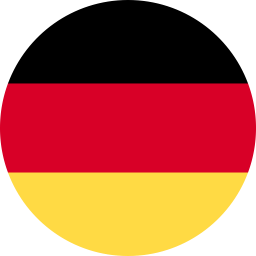
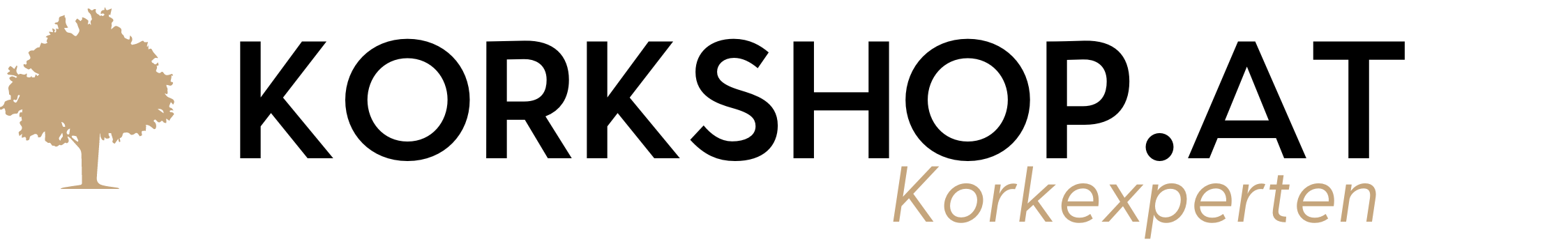





Wir verwenden Ihren Namen und Kommentar, um diese öffentlich auf dieser Webseite anzuzeigen. Ihre E-Mail soll gewährleisten, dass der Autor dieses Posts die Möglichkeit hat, sich bei Ihnen melden zu können. Wir versprechen, Ihre Daten sicher und geschützt aufzubewahren.